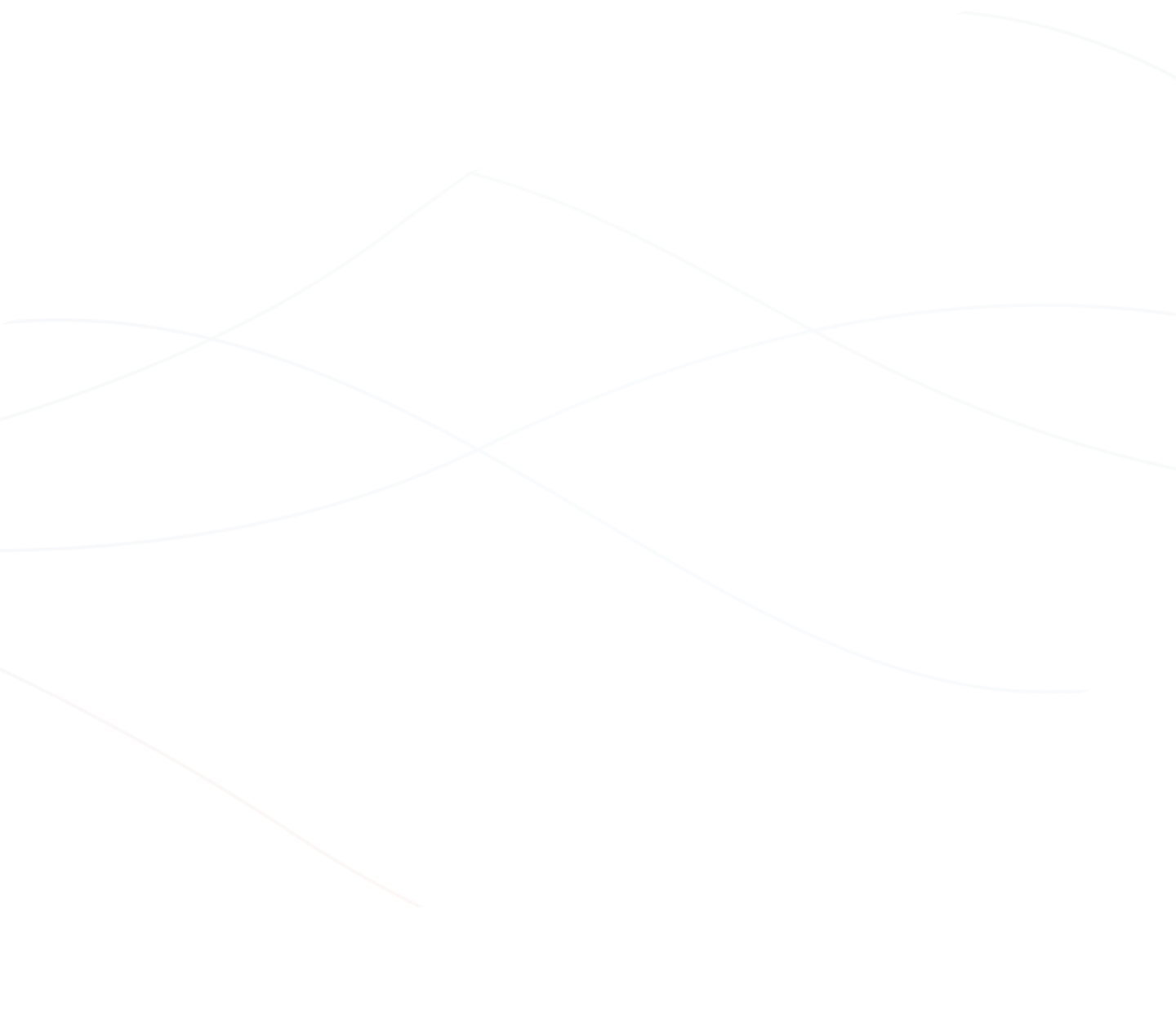Eines der Ziele des KTUR²-Projekts ist es, den Zugang von KMU zu grenzüberschreitenden Forschungsressourcen zu verbessern – durch die Identifizierung bestehender Infrastrukturen, die Förderung der Zusammenarbeit mit Hochschulen und den Aufbau nachhaltiger Kooperationsmodelle.
Danièle Schmitt (CCI Alsace Eurométropole) und Jean Pacevicius (Hochschule Offenburg), Mitglieder der KTUR-Arbeitsgruppe 1 für Forschung und Infrastrukturen, teilen ihre Sicht auf die Herausforderungen und Perspektiven mit den 15 Partnern des trinationalen Konsortiums.
Frage 1. Bestehendes verstehen
Wo beginnt man bei einer so ambitionierten Aufgabe?
Danièle Schmitt : Um ein so ambitioniertes Vorhaben wie die Verbesserung des Forschungszugangs am Oberrhein zu starten, müssen zunächst klare Grundlagen geschaffen werden.
Das beginnt mit der Definition des Begriffs „Forschungsinfrastruktur“ (Labore, Plattformen, Fablabs, Datenbanken usw.) und der Erfassung bestehender Ressourcen. Diese Arbeit wurde bereits in zwei vorrangigen Bereichen begonnen: Robotik und Materialien – mit Fallstudien der Hochschule Offenburg und der Duale Hochschule Lörrach. In Elsass wurden bereits rund sechzig Infrastrukturen identifiziert.
Der nächste Schritt besteht darin, die Zugangsbedingungen zu analysieren, grenzüberschreitende Gemeinsamkeiten zu identifizieren und rechtliche sowie wirtschaftliche Aspekte (Vertragsmodelle, Kosten, Betrieb) zu prüfen.
Das Themenspektrum wird erweitert und die Schweizer Partner werden in den Prozess eingebunden.
Kurz gesagt: Wir beginnen mit Erfassen, Analysieren und Harmonisieren, um die Infrastrukturen für Unternehmen sichtbarer und zugänglicher zu machen.
Frage 2. Brücken durch Expertise bauen
Welche Rolle spielt der „Expert Pool“ in diesem Prozess?
Jean Pacevicius : Der Expert Pool wurde eingerichtet. Forschende der Hochschule Offenburg und der Duale Hochschule Lörrach werden in den kommenden Wochen auf Basis der erfassten Infrastrukturen Fallstudien durchführen. Erste Rückmeldungen werden im Herbst erwartet.
Frage 3. Kooperation in der Praxis testen
Wo stehen Sie am Ende des ersten Projektjahres von KTUR²?
Danièle Schmitt : Wir bereiten derzeit zwei praktische Kooperationsfälle vor. Eine Liste verfügbarer Infrastrukturen wurde an die Forschenden übermittelt, die nun auswählen, mit welchen sie arbeiten möchten. Diese Auswahlphase ist noch im Gange und ist entscheidend für die Durchführung der Feldtests.
Frage 4. Auf dem Weg zu einem grenzüberschreitenden Kooperationsmodell
Welches Kooperationsmodell möchten Sie aufbauen?
Jean Pacevicius : Wir streben ein Modell an, das auf konkreten Synergien bei der gemeinsamen Nutzung von Infrastrukturen am Oberrhein basiert. Dafür sind zunächst Fallstudien notwendig, um mögliche Kooperationspotenziale zu identifizieren und die wiederkehrenden Bedürfnisse der Unternehmen besser zu verstehen.
Frage 5. Koordination und Bearbeitung von Anfragen
Und organisatorisch – wie gehen Sie mit Anfragen von Unternehmen um?
Danièle Schmitt : Im KTUR-Netzwerk wurde ein Koordinationsverfahren eingeführt: Kann ein Partner eine Anfrage nicht bearbeiten, wird sie an ein anderes Mitglied mit entsprechender Expertise weitergeleitet – basierend auf einer thematischen Zuordnung der Hochschulen und unter Wahrung der Vertraulichkeit. Dieses Verfahren wird derzeit mit konkreten Unternehmensfällen getestet.
Parallel dazu werden Laborbesuche organisiert, um die Ressourcen am Oberrhein besser bekannt zu machen, grenzüberschreitenden Austausch zu fördern und gemeinsame Projekte anzustoßen. Ziel ist es, ein strukturiertes regionales Innovationsökosystem zu schaffen – als vernetztes System, nicht als Einzelakteure –, das für Unternehmen zugänglich ist.