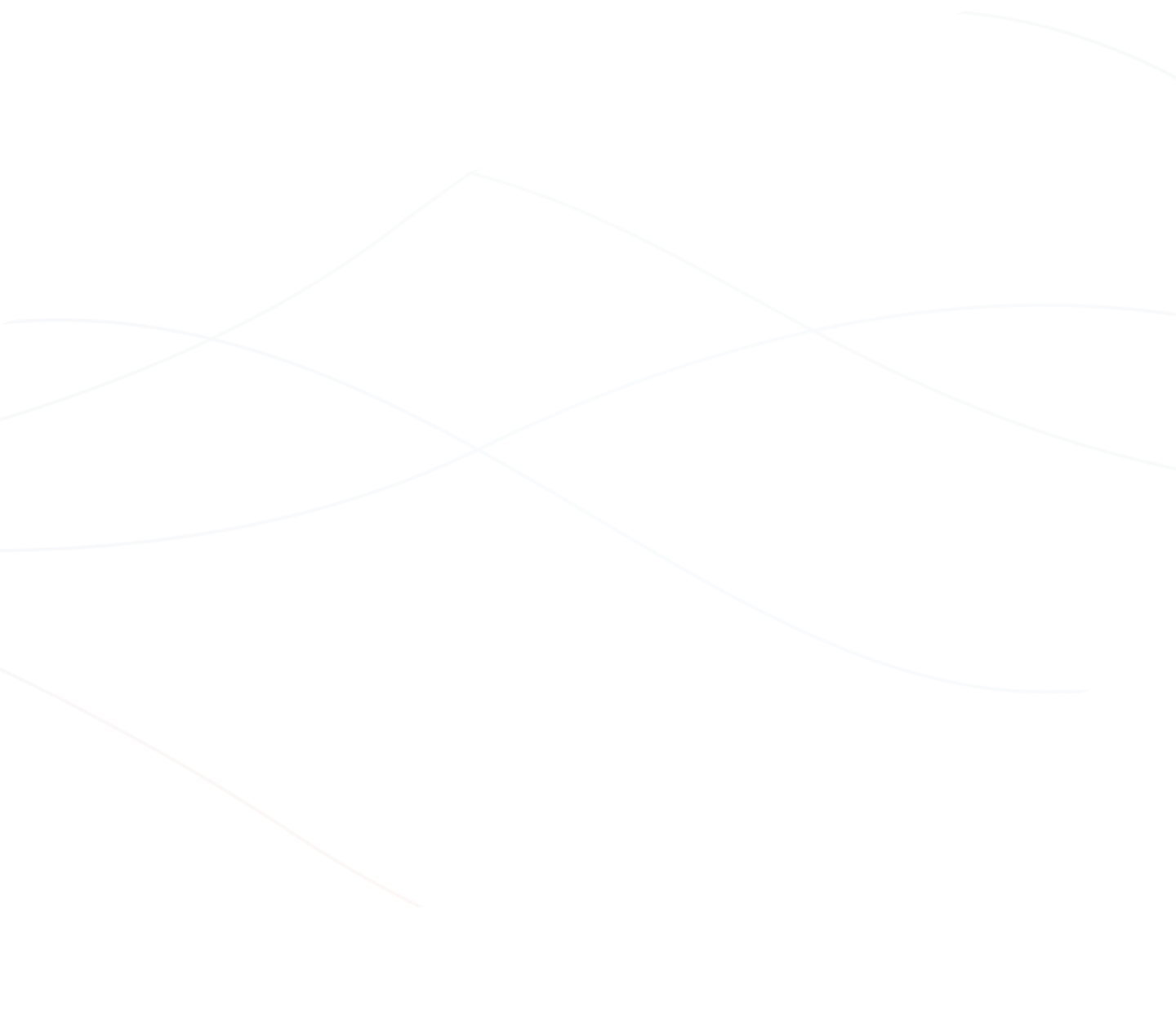Rhinepreneurs – Episode 2: Ein Blick in Impact Venture Capital – Ein Gespräch mit Claire Weiss von Phitrust
6 Januar 2026
Wie können Investitionen sowohl finanzielle Rendite als auch positiven gesellschaftlichen Wandel schaffen?
In der zweiten Folge des Rhinepreneurs-Podcasts, präsentiert von KTUR (Knowledge Transfer Upper Rhine), taucht Gastgeberin Sandra gemeinsam mit Claire Weiss, Impact Analystin bei Phitrust, in die Welt des Impact Investings ein. Phitrust zählt zu den europäischen Vorreitern in diesem Bereich.
Vom Idealismus zur Wirkung
Claires Weg ins Impact Investing begann mit einer grundlegenden Frage: Wie lassen sich wirtschaftliche Aktivitäten mit persönlichen Werten in Einklang bringen?
Aufgewachsen im Elsass in einer Ärztefamilie, wurde sie früh von dem Gedanken geprägt, einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Während ihres Studiums an der Sciences Po und ihres Erasmus-Jahres am KIT Karlsruhe entdeckte sie ihre Leidenschaft für Social Entrepreneurship — und fand schließlich ihren Weg zu Phitrust nach Paris.
Phitrust: Investieren für Veränderung
Phitrust wurde vor über 20 Jahren gegründet und gehört zu den ersten Unternehmen in Europa, die finanzielle Performance mit messbarem sozialem Impact verbinden.
Heute verwaltet Phitrust mehr als 100 Millionen Euro in vier Fonds und unterstützt über 40 soziale Unternehmen in Bereichen wie Inklusion, Gesundheit und Bildung.
Als Impact Analystin verbindet Claire analytische Arbeit mit Empathie: von der Bewertung von Geschäftsmodellen und Risiken bis hin zum engen Austausch mit Gründer:innen, die gesellschaftliche Herausforderungen lösen wollen. Ihre Arbeit zeigt, dass Impact Investing weit mehr ist als Zahlen — es geht um Menschen, Vertrauen und gemeinsame Werte.
Wirkung messen – das Wesentliche im Blick
Eine der größten Herausforderungen im Impact Investing ist die Messung der tatsächlichen Wirkung.
Phitrust hat dafür eine eigene Impact-Methodik entwickelt, die über zwei Jahrzehnte hinweg verfeinert wurde, und nutzt anerkannte Frameworks wie die Theory of Change und das Impact Management Project (IMP). So werden sowohl finanzielle Ergebnisse als auch gesellschaftliche Wirkungen systematisch erfasst.
Tipps für Start-ups: Sinn und Leistung vereinen
Claire gibt auch wertvolle Ratschläge für Gründer:innen, die sich an Impact Investor:innen wenden. Viele unterschätzen, wie anspruchsvoll — aber auch bereichernd — dieser Prozess ist. Ihr Rat: Purpose und Performance müssen zusammenpassen.
Eine überzeugende Impact-Vision braucht ein solides Geschäftsmodell. Ebenso wichtig sind Authentizität, Transparenz und die Bereitschaft zu einer langfristigen Zusammenarbeit. Wie Claire sagt: Eine Investition mit Phitrust ist „fast wie eine Ehe“ — basierend auf Vertrauen, Geduld und gemeinsamen Werten.
Ausblick: Wenn Impact zur Selbstverständlichkeit wird
Claire hofft auf eine Zukunft, in der Impact Investing nicht mehr als Sonderfall gilt, sondern zum Standard wird.
Ihre Vision: „Impact sollte kein Trend oder Nischenthema mehr sein, sondern ein integraler Bestandteil von Wirtschaft und Gesellschaft.“
🎧 Jetzt die ganze Folge anhören: Rhinepreneurs – Episode 2: Inside Impact Venture Capital
Spotify oder Apple Podcast